| von Antonia Skiba |
Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine steht Osteuropa stark im Zentrum politischer Debatten. Dabei wird das nationalstaatliche Paradigma unhinterfragt übernommen, was zu einem verzerrten Bild dieses geographischen Raums führt.
Die Region Osteuropa ist trotz des Krieges in der Ukraine für viele Menschen immer noch ein blinder Fleck. Einige assoziieren mit dem östlichen Europa einen Raum, der von Armut, Postkommunismus und gesellschaftlicher Rückständigkeit geprägt sei. Andere romantisieren wiederum die postsozialistische Ästhetik oder verkürzen slawische Kulturgeschichte als christlich, weiß und irgendwie europäisch – aber auch nicht so ganz europäisch.
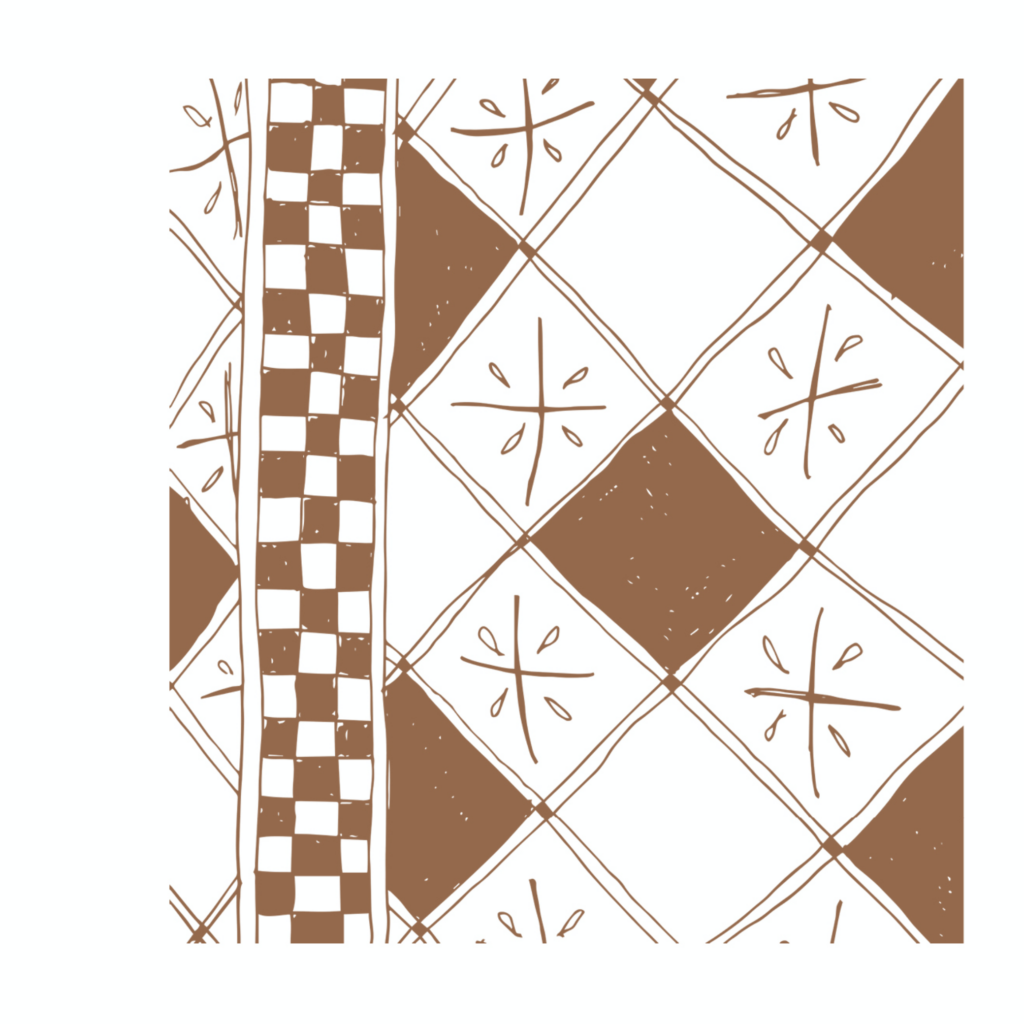
Was hat es nun eigentlich mit diesem geographischen und politischen Raum auf sich? Wie können wir die Geschichte dieser Region verstehen? Und welche Forschungsperspektive kann uns dabei helfen?
Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir allerdings einen Schritt zurückgehen und nachvollziehen, wie genau die herkömmliche Geschichtswissenschaft in Deutschland funktioniert. Der sogenannte „nationale Denkrahmen“1 bestimmt – wenn auch seit den 1990er Jahren mehrfach kritisiert – immer noch stark die Geschichtsschreibung. Historiker_innen untersuchen vergangene gesellschaftliche Phänomene oder Phasen in ihren territorialen Grenzen und beziehen erst in der sogenannten Beziehungsgeschichte das zwischenstaatliche Verhältnis zu anderen Nationen ein. Die nationale Ordnung bildet also stets den Maßstab, an dem historische Entwicklungen einer homogen kodierten Gesellschaft analysiert werden.
Ebenso handelt es sich bei einer nationalgeschichtlichen Perspektive nicht um einen politisch neutralen Blick auf Vergangenheit. Diese Betrachtungsweise geht immer von einem sinnstiftenden „Wir“2 aus, welches auf eine scheinbar historische Notwendigkeit eines Kollektivs (in dem Fall die konstruierte Nation) schließen lässt. So lenkt eine nationale Geschichtsschreibung an Universitäten sowie im Schulunterricht die Aufmerksamkeit auf eine erfundene Schicksalsgemeinschaft, die sich angeblich durch jahrhundertelange Kontinuität und gemeinsame Identität auszeichnet – beides aber konstruierte Vorstellungen sind.3
Wenn wir nun die Geschichte Osteuropas begreifen möchten, kommt diese Forschungsperspektive sehr schnell an ihre Grenzen. Osteuropäische Staaten sind nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten sowie nach dem Zerfall Jugoslawiens erst seit etwa 30 Jahren souveräne Nationalstaaten. Vorher handelte es sich um eine Region, die stets Vielvölkerstaaten hervorbrachte. In diesen Vielvölkerstaaten bildeten Mehrsprachigkeit, ethnische Heterogenität und kulturelle sowie religiöse Koexistenz die Normalität ab. Landesgrenzen verschoben sich in kurzen Abständen, existierten teilweise kaum. Außerdem war die Idee der Nation in Osteuropa ähnlich wie in Westeuropa besonders im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit mit politisch privilegierten Schichten verknüpft. Es handelte sich dabei um eine „ständische Nation“,4 die sich ausschließlich aus Adel und Funktionseliten zusammenstellte. Diese „Verschränkung von Standesbewusstsein und Nationszugehörigkeit“5 spiegelte daher nur die Lebensrealitäten eines sehr kleinen und exklusiven Teils der Bevölkerung wider. Die Geschichte Osteuropas kann demnach nicht einfach durch eine Aneinanderreihung nationaler Großereignisse wie zyklische Wechsel des jeweiligen politischen Führungspersonals oder zwischenstaatliche Auseinandersetzungen erklärt werden.
Die herkömmliche Geschichtswissenschaft bietet in dieser Hinsicht allerdings auch Alternativen an. So sprechen Historiker_innen häufig von „Globalgeschichte“, „Weltgeschichte“, „europäischer Geschichte“ oder „transnationaler Geschichtsschreibung“ und plädieren für eine historische Forschungsperspektive, die über nationale Grenzen hinausdenkt. Trotzdem gehen diese Betrachtungsweisen immernoch von nationalen Narrativen und nationalstaatlichen Ideologien aus, welche Osteuropa als Region nicht bieten kann, sondern nur von außen in sie hineingelegt wird. Der Ausgangspunkt ist demnach immer wieder der nationale Container, der einen scheinbar objektiven und unparteilichen Rahmen vorschreibt.
Wir stellen also fest: Nationale Geschichtsschreibung erfüllt eine klare Funktion für moderne Nationalstaaten, die sich seit dem 19. Jahrhundert entwickelt haben. Sie bindet ein willkürlich ausgewähltes und kategorisiertes ‚Volk‘ als Kollektivsubjekt an eine kulturelle Entstehungsgeschichte sowie an ein historisch zufällig eingegrenztes Territorium und postuliert so die Entwicklung einer vermeintlich einvernehmlichen Wertgemeinschaft. Damit liefert die nationale Geschichtsschreibung eine herrschaftsstützende Legitimation für das politische Konstrukt des Nationalstaats. Auf diese Weise werden Herrschaft, Nation und Staat naturalisiert und als scheinbar organisch gewachsene Gesellschaftsprozesse begriffen. Die so institutionalisierte Geschichtsschreibung verfolgt dabei das Ziel, nationale Herrschaft mithilfe von historischen Kollektiverfahrungen glaubhaft, erfahrbar und fühlbar zu gestalten.
Wenn aber weder die Kategorie Nation, noch die Zugehörigkeit zu einer Elite die Geschichte Osteuropas erläutern, wie können wir diese Region dann geschichtswissenschaftlich genau erfassen? Eine alternative Perspektive hierzu wäre, die Geschichte Osteuropas nicht als Geschichte von Nationen oder als „die Summe verschiedener Nationalgeschichten“6 zu betrachten, sondern als eine Geschichte von Verflechtungen. Dabei „richtet sich [dieser Verflechtungsraum] nicht nur nach administrativen Grenzen, sondern vor allem nach der Lebenswirklichkeit seiner Bewohner“7. Das bedeutet, dass die sozialen Verhältnisse jenseits des Adeltums uns etwas über einen weiteren Maßstab der historischen Analyse verraten.
Das lässt sich sehr anschaulich im folgenden Reisebericht eines britischen Diplomaten aus dem Jahre 1918 erkennen:
„Wenn man einen durchschnittlichen Bauern in der Ukraine nach seiner Nationalität fragt, wird er antworten, er sei griechisch-orthodox; wenn man ihn drängt zu sagen, ob er ein Großrusse, ein Pole oder ein Ukrainer sei, wird er wohl antworten, er sei Bauer; und wenn man darauf besteht zu erfahren, welche Sprache er spricht, wird er sagen, dass er ‚die Sprache von hier‘ spricht […]. Wenn man also herausfinden will, welchem Staat er gerne angehören möchte_– ob er von einer allrussischen oder einer besonderen ukrainischen Regierung regiert werden möchte –, wird man erfahren, dass seiner Meinung nach alle Regierungen eine Landplage seien und dass es das Beste wäre, wenn das ‚christliche Bauernvolk‘ sich selbst überlassen bliebe.“8
Was sich hier als kompliziertes Gespräch mit einem Bauern auftut, der die Nachfragen des Diplomaten scheinbar nicht richtig versteht, mündet beinahe schon in eine allgemeine Kritik an Obrigkeit oder Staatlichkeit. Die Idee der Nation und der damit einhergehenden Herrschaft über eine Bevölkerung ergab für den Großteil der damaligen Landbevölkerung Osteuropas keinen Sinn. Wenn es nicht die Religion ist, die auf eine nationale Zugehörigkeit schließen lässt, dann ist es die Sprache. Wenn die Sprache aber nicht einheitlich ist, dann soll die Loyalität zur jeweiligen Herrschaft herhalten – und wenn man diese nicht vorfindet, hat man plötzlich einen Staatsfeind vor sich. Dieser Umstand deutet darauf hin, dass Nationalität eben keine historisch widerspruchsfreie, fast natürliche Eigenschaft eines ‚Volks‘ in einem bestimmten Territorium ist, sondern als politisches Konstrukt zum Zweck der Herrschaftssicherung der Bevölkerung übergestülpt und von außen zugeschrieben wurde.
Osteuropa als einen Verflechtungsraum zu sehen, bedeutet demnach, die Menschen vor Ort nicht als homogenes Kollektiv zu behandeln, welches sich durch die Kategorie Nation definiert, sondern durch Kategorien wie Klasse, Berufsstand, Religion oder Dialekt. Diese Forschungsperspektive führt uns im nächsten Schritt dahin, die moderne Erfindung der Nation und unsere eigene Rolle in dieser Nation zu hinterfragen. Eine nationale Geschichtsschreibung scheint die einfache, die logische Lösung für die historiographische Untersuchung von vergangenen Ereignissen zu sein – aber sie bildet nie die historische Realität der Menschen ab, die sie in der Masse betrifft.
1 Angster, Julia: Nationalgeschichte und Globalgeschichte. Wege zu einer „Denationalisierung“ des historischen Blicks, 23.11.2018. Online unter:https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/280566/nationalgeschichte-und-globalgeschichte/
2 Zur Kritik der Geschichtswissenschaft. Die verkehrte Logik und der weltanschauliche Unsinn des historischen Denkens, GegenStandpunkt 02/2019. Online unter: https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/zur-kritik-geschichtswissenschaft
3 Forum H-Soz-Kult: Nation. Zur Rolle der Nation in der Geschichtsschreibung des 21. Jahrhunderts, 08.09.2021. Online unter:www.hsozkult.de/debate/id/fddebate-132446
4 Ekaterina Emeliantseva; Arié Malz; Daniel Ursprung (2008): Einführung in die osteuropäische Geschichte. Zürich: Orell Füssli, S. 75.
5 Ebd.
6 Frank Grelka (18.10.2022): Rezension zu: Roland Borchers; Alina Bothe; Markus Nesselrodt; Agnieszka Wierzcholska (Hrsg.): Das östliche Europa als Verflechtungsraum. Agency in der Geschichte. Berlin: Metropol Verlag, 2021. Online unter: https://www.hsozkult.de/searching/id/reb-117510
7 Osteuropainstitut, Freie Universität Berlin: Osteuropa im transnationalen Verflechtungsraum. Online unter: https://www.oei.fu-berlin.de/Forschung/index.html
8 Orlando Figes (2008): Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924, Sonderausgabe, Berlin, S. 92.

