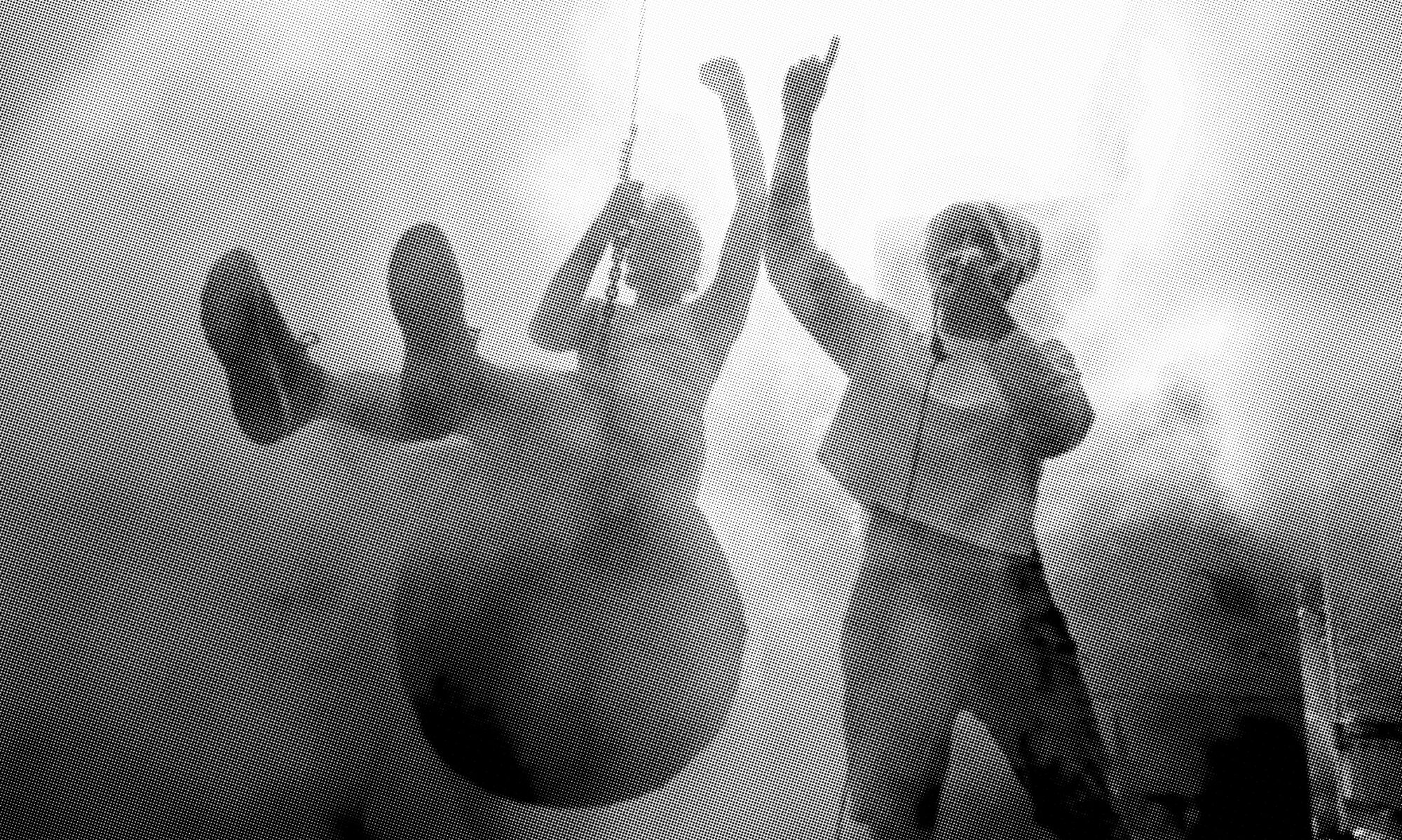| Cindy Kosseda |
ÜBER DIE MEME-KÜNSTLERIN SVEAMAUS
Memes können mehr als nur witzig sein. In 1080 × 1080 Pixel gelingt es der Meme- Künstlerin Sveamaus schlagkräftige Gesellschaftskritik zu üben. Wie schafft sie diesen Spagat und erreicht dabei noch so viele Menschen?
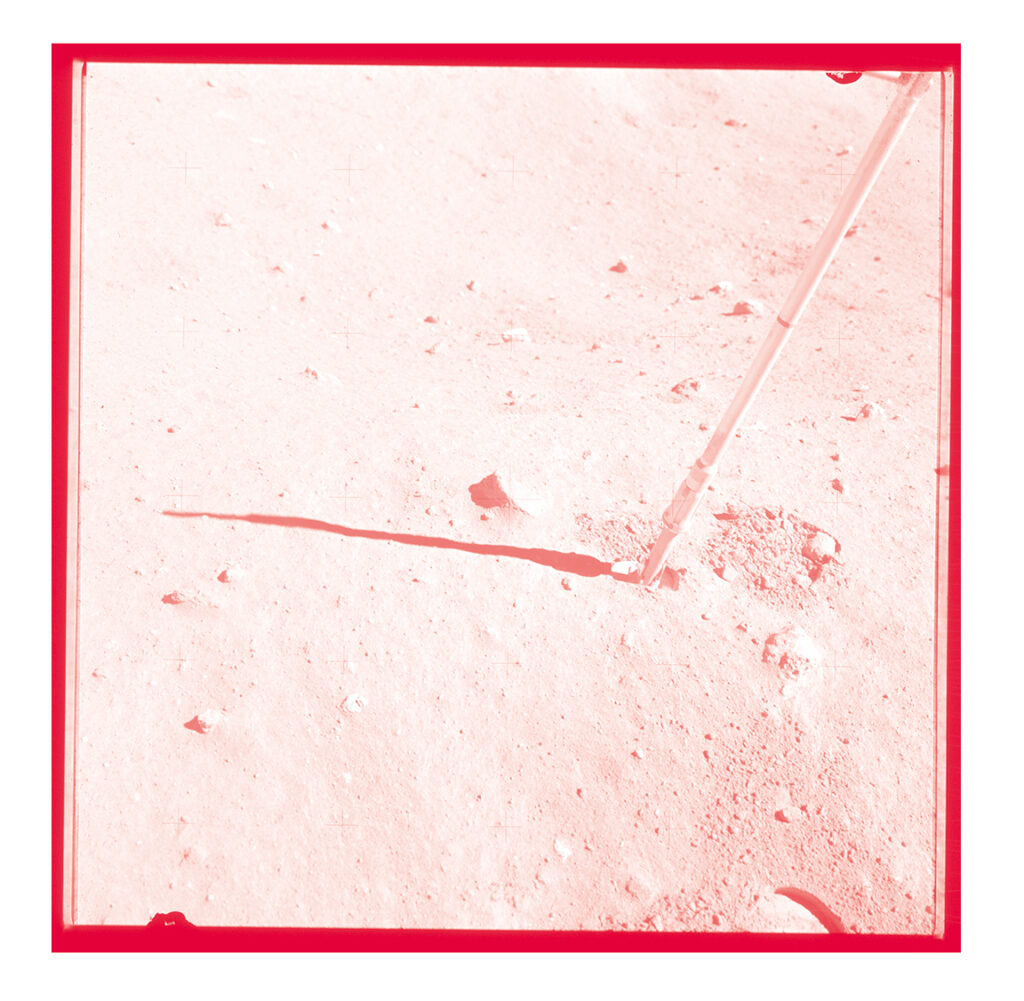
Eminem als linker Macker, Merkel als Studi-WG Mitglied, jegliche NRW-core Stereotype und “Wo ist die Clit?”-Witze treffen den Zeitgeist. Svea Mausolf ist unter Sveamaus auf Instagram bekannt und ihre schlagfertigen Memes begeistern über 200 Tausend Menschen, die sich mit Follows und Likes bedanken. Schon lange ist die deutsche Memelandschaft politisiert, doch Sveamaus ist ein neuer Stern am Himmel der digitalen Witzbolde. Allein ihr Künstler_innenname ist nicht nur eine Zusammensetzung aus ihrem Vor- und Nachnamen, sondern verkörpert den Internettrend des Maus-Kosenamens. Unter dem Titel „Ja Chef, bin dran“ tourt Sveamaus gemeinsam mit Julius Vapiano durch Deutschland. Vapiano, ironischerweise eine deutschlandweit bekannte Restaurantkette, ist Autor, Künstler und Herausgeber des Kölner Kritik- und Literaturprojekts „It Tastes Like Ashes“. Unter anderem veröffentlichte er in seinem typischen Format das Buch „How To… Cook“, in dem 22 Lektionen aus der Gastro geteilt werden. Ebenso wie Sveamaus beschäftigt er sich mit der Widrigkeit und Absurdität des Arbeitslebens.
Im Gegensatz zu ihrem Kollegen hat Mausolf nie ein Buch veröffentlicht — trotzdem bringt sie unterhaltsame, witzige Texte unters Volk. Kurzgeschichten zu weirden Situationen am Arbeitsplatz und Privatleben stehen auf dem Programm. Von Candy Crush auf der Bürotoilette über feuchte, lesbische Träume mit Filmstars bis hin zu Kund_innen, die sich an der Kasse einscheißen. Während Themen wie ein nerviger Bürojob bei einer Firma, die Deko-Artikel aus China verkauft, eine breitere Masse anspricht als Geschichten über den ersten lesbischen Club-Make-Out, bleibt das Publikum im Lesungsraum selten still. Die Schenkelklopfer bleiben dabei nicht aus, dennoch geht es bei Mausolf um mehr als nur Witze.
VON MEME ZU MIMETISCH
Memes haben eine politische, kulturelle und gesellschaftliche Funktion1. Bei allen drei Komponenten geht es um Gruppenzugehörigkeit: Nur wer einer gewissen Gruppe angehört, kann gewisse Insider-Witze verstehen. Für Memekünstler_innen zählt die Fähigkeit Gemeinsamkeiten einer Gruppe zu beobachten und diese Ähnlichkeiten in ihren Memes hervorzubringen. Das Wort „Meme“ kommt vom altgriechischen Mimea, das „Nachgeahmtes“ bedeutet. Im Sinne von Mimikry sind Memes also Nachahmungen unserer Gesellschaft.
Bereits Platon und Aristoteles haben sich mit Mimesis aus philosophischer Perspektive auseinandergesetzt. Dabei galt die Kunst auch als etwas Nachgeahmtes – man verstand sie als Reproduktionen vom Schönen für ästhetische Zwecke. Die fehlende Funktionalität nach dieser Definition bedeutete in der Antike, dass Kunst keinen Platz in der Idealgesellschaft hat und galt somit als unmoralisch2. Dieser philosophische Ansatz setzte sich bis in die Romantik fort und das Blatt wendete sich. Josef Früchtl schildert die darauffolgenden Entwicklungen: „die Philosophie des deutschen Idealismus und der Romantik ermöglicht also eine Synthese von Mimesis und Subjektivität. Genauer gesagt, ermöglicht sie auf der Basis des Subjektivitätsprinzips eine Fassung des Mimesisbegriffs, die dessen von Anfang an präsente und auseinanderstrebende Pole: Nachahmung und Schöpfung, Imitation und Kreation, konsistent zusammenfügt.3“ Memes befinden sich genau an dieser Schnittstelle, besonders die digitalen Kunstwerke von Sveamaus, bei denen einerseits Teile der Realität nachgeahmt werden und andererseits durch die Selektion, Kompostion und Beschriftung eine neue Subjektivität ins Leben gerufen wird. Die Kunst scheint unvergleichbar, jedoch bleibt sie zugänglich für viele und vor allem begeistert sie.
Neben der philosophischen Geschichte gibt es bei der Mimesis auch einige kultur- und sozialwissenschaftliche Einflüsse. Walter Benjamin geht einen Schritt zurück und sieht die Mimesis als grundlegend für soziale und kulturelle Prozesse. Dabei bezieht er sich auf unterschiedlichste gesellschaftliche Rituale, wie beispielsweise die Sprache, bei der Wörter Nachahmungen der Wirklichkeit sind. So werden Buchstaben und Wörtern eine unsinnliche Ähnlichkeit zu deren Bedeutung zugeschrieben. Denn das ausgeschriebene Wort Haus und ein echtes Haus sehen sich kein bisschen ähnlich, also gibt es keine sinnliche Ähnlichkeit. Ein weiteres Beispiel, das Benjamin nutzt, sind die Sternzeichen die Menschen über lange Zeit, bis heute sehr beliebt in der queeren Community, zugeschrieben wurden. Durch unsere Sinne ist keine Ähnlichkeit zwischen der Sternkonstellation erkennbar, doch einige können einen toxischen Zwilling direkt erkennen, als wäre es auf der Stirn geschrieben.
Sveamaus scheint über die Gabe zu verfügen, gewisse Gesellschaftszustände abzubilden. In ihren Memes sind beklemmend eingerichtete 2010er Essbereiche mit Holz- und Edelstahl-Garnitur abgebildet und ihre Schriftzüge weisen auf unangenehme Kommentare und von Verwandten hin. Während die Inneneinrichtung weit verbreitet und sinnlich wahrnehmbar ist, also eine sinnliche Ähnlichkeit in der deutschen Kultur widergibt, sind die Ähnlichkeiten der Kommentare, die Unbehagen bei Millennials und Gen-Zs auslösen, ein ungreifbares Ritual und somit eine unsinnliche Ähnlichkeit. Solche Ähnlichkeiten zu erkennen, wird nach Walter Benjamin als mimetisches Vermögen bezeichnet.4
Die gewählten Subkulturen, Stereotype und Situation, die die Memes bildlich aufrufen, sind spezifisch und weit verbreitet zugleich, sodass eine große Bandbreite von Gen-Zs und Millennials relaten kann. Dabei macht sich Sveamaus über Personas lustig, denen fast alle In-Großstädten-Lebenden bereits begegnet sind: esoterische Hippies, reiche, selbsternannte feministische Filmstudenten, Hete-Frauen im Wollstirnband, die Schwule süß finden, aber Lesben hingegen eher weniger. Alle sind Teil von Kulturprozessen und gruppen mit sinnlichen und unsinnlichen Ähnlichkeiten. Sveamaus hat ein Auge fürs Detail und stellt diese im Internet zur Schau.
MINI-REVOLUTION IM INTERNET
Die Kunst lässt sich meist nicht von den Künstler*innen trennen. Ihre Identität und ihre Erfahrungen haben meistens Einfluss auf ihre Werke. Auch bei Sveamaus sollten wir uns bewusst machen, dass sie ein ostdeutsche, lesbische, in Köln lebende Filmabsolventin ist, die einen Arbeitsalltag im Büro verfolgt. Und an ihren Memes sieht man: Man kann lustig und politisch korrekt sein. Die dargestellten Charaktere sind meist privilegiert, weiß und heterosexuell. Häufig setzt Sveamaus ihnen Gesichter von Annalena Baerbock und Friedrich Merz auf, ihre Comedy wird zur politischen Satire. Sie selbst teilt dem NDR mit, dass ihre persönliche Perspektive eine Rolle in ihrer Kunst spielt:
„Ich setze mich aufgrund meiner eigenen Homosexualität sehr mit LGBTQ+-Themen auseinander und mit Diskriminierung. Ich finde es super wichtig, da eine Bresche zu schlagen und dagegen mit Humor anzukämpfen, weil das auch oft sehr entwaffnend ist.“3
Somit sind ihre Memes eine Umkehrung der Machtverhältnisse. Sveamaus erschafft ein digitales Paralleluniversum, in dem queere Frauen sich auf die Schenkel klopfen. Ihre Pointen sind weitaus kreativer als die derjenigen Satiriker_innen oder Comedians, die nur nach unten treten, sich ausschließlich über Azubis, Ehefrauen oder Migrant_innen lustig machen. Viele fühlen sich von diesem modernen Humor verstanden. Hier setzt sich die Mimesis als Anerkennung fort, denn Sveamaus‘ Memestil wird häufig von anderen Meme Accounts nachgeahmt.
Der Duft von Wandel liegt in der Luft, oder sollte man eher sagen im Netz? Wie dem auch sei — wir können eine Mini-Revolution, übertragen durch Nullen und Einsen, beobachten.
Somit gelingt es Sveamaus das Lebensgefühl von Gen-Zs und Millenials einzufangen. Sich über Bürojobs zu beschweren, gehört seit langem zur deutschen Leitkultur, doch viele junge Menschen beschäftigt mehr als nur die Angst vor einem eintönigen Alltag. Im Spätkapitalismus6 ahnen einige vielleicht Böses. Die Glaubenssätze, die uns als Kindern mitgegeben wurden, wie „du schaffst den sozialen Aufstieg, wenn du das machst, was du liebst und dich dabei richtig anstrengst“ erweisen sich als Illusion und leere Versprechen. Globale Krisen, Informationsüberflutung und Inflation sind die Realität dieser Generation. Nicht ohne Grund haben die neuen Generationen mehr Ängste als je zuvor.7 Doch eine Nachricht, die die Memes sowie die Lesung vermitteln, ist: „Du bist nicht allein” und „wir können sogar darüber lachen.”
- Ben Kendal in „Meme-Forscherin im Interview: ,Memes sind eine Art Insiderwitz im Internet‘“ (rnd.de, 2021)
- Arne Melberg in „Plato’s ,Mimesis‘“ (Theories of Mimesis, 1995)
- Josef Früchtl in „Mimesis“ (Suhrkamp, 2024)
- Walter Benjamin in „Über das Mimetische Vermögen“ (Gesammelte Schriften Band II, 1977)
- Vanessa Wohlrath in „Was macht eigentlich eine Meme-Künstlerin, Sveamaus?“ (NDR.de, 2023)
- Ein Begriff, der vom Marxistischen Ökonom Ernest Mandel genutzt wurde, um die wirtschaftliche Entwicklung nach Ende des zweiten Weltkriegs zu beschreiben
- Ängste äußern sich unterschiedlich, die folgenden Studien greifen es sehr gut auf: Trendstudie von Simon Schnetzer et al. „Jugend in Deutschland 2024“ und Studie von University of Bath „Young People’s Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon“