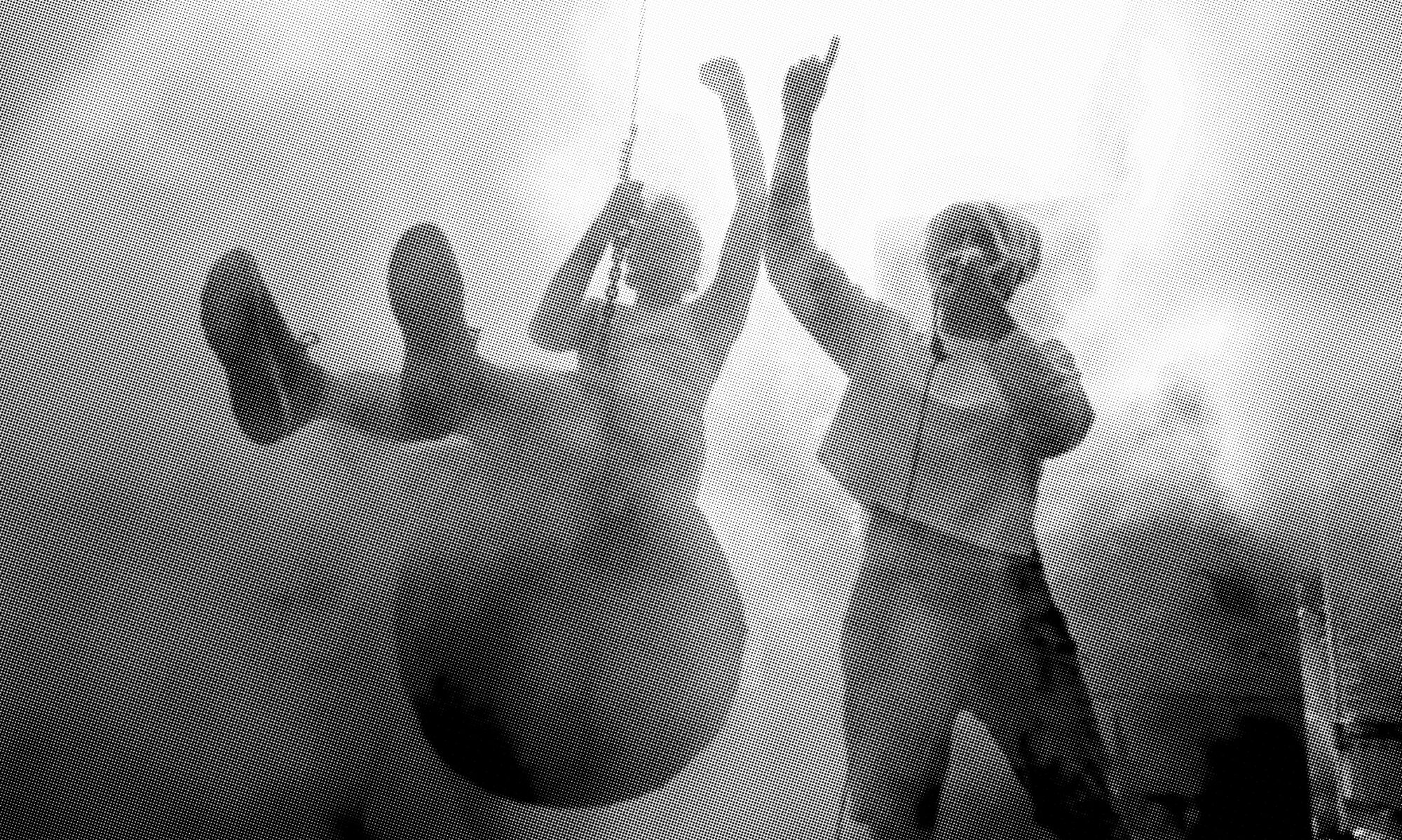| Laura Brauer |
ZUR KAPITALISIERUNG EINER INTERSEKTIONALEN DISKRIMINIERUNG
Eine Vielzahl von Hautpflegeprodukten wird mit Beschreibungen wie „unrein“, „lästig“ oder „problematisch“ beworben. Dabei bedient sich die Kosmetikindustrie nicht nur weit geläufiger, auf tiefgreifenden Diskriminierungsstrukturen beruhender Stigmatisierungen, sondern sie reproduziert und konventionalisiert diese. Und die Auswirkungen dieser Konventionalisierung sind kaum zu unterschätzen: Karrierechancen, mental health, Partner:innenwahl und Konsumverhalten. Obwohl die Problematiken im gesellschaftlichen
Umgang mit Hautauffälligkeiten mittlerweile gut erforscht sind, zeichnen sich fragwürdige Tendenzen in der sog. „Skin Positivity Movement“ ab. Ein Plädoyer, weshalb wir die gesamtgesellschaftliche Dimension dermatologischen Erscheinungsbildes ernst nehmen sollten.
„Die Haut als Spiegelbild der Seele.“ Sogar medizinische Hautpflegemarken (sog. Dermo-Cosmetics)1 wie Dermasence und Eucerin werben mit dieser profanen Binse.2 Noch häufiger bemühte Reklamevokabeln sind „fettige“ und „unreine“ Haut.3 Wo Mediziner:innen mindestens sechs verschiedene Arten von Pickeln (wie z. B. Papeln, Pusteln, Knoten und Zysten) differenzieren, haben sie zusammengefasst unter dem Begriff „Unreinheiten“ Eingang in unseren alltäglichen Sprachgebrauch gefunden.4 Und obwohl Akne, Rosazea und Schuppenflechte rein statistisch derart gehäuft auftreten, dass sie als „Volkskrankheiten“ gelten dürfen5, ist ein normalisierter gleichsam medizinisch fachlicher Umgang mit Hauterkrankungen kaum in Sicht. Sie werden in einer breiten Bevölkerung eher als „kosmetische Irritationen“, weniger als psycho-somatische Erkrankungen wahrgenommen.6 Mit den richtigen „Reinigungsmitteln“ und „Pflegeroutinen“ würden sich „unschöne Hautprobleme“ lösen. Diese wording hebt auf mangelhafte Hygiene ab und hält damit einen längst in der Forschung widerlegten Mythos am Leben. In der omnipräsenten Werbewelt liegt überdies eine ausgeprägt schönheitsnormierende Suggestiv- und Selektivkraft, die auf tiefgreifenden Sexismen und Rassismen beruht.
GESELLSCHAFTSGESCHICHTE „MAKELLOSER“ HAUT
Die Idealisierung heller, glatter und jugendlicher Haut sowie die Stigmatisierung von davon abweichenden Erscheinungsbildern hat auf dem europäischen Kontinent eine erstaunlich lange Kontinuität. Schon im Alten Testament wurde „Aussatz“ (Lepra) als göttliche Strafe gedeutet. Betroffene wurden von Priestern für „unrein“ erklärt, was unweigerlich den Ausschluss aus der Gemeinschaft nach sich zog.7 Bleiweiß und Puder verwendeten bereits antike Griechinnen, um ihren Teint aufzuhellen.8 Besonders prominent wurde der „Marmor-Teint“ im englischen Hochadel, wobei Elisabeth I. (auch „Elfenbein-Regentin” genannt) den Nebenwirkungen des jahrelangen Auftragens der prestigeträchtigen Bleiweißschminke durch Abhängen sämtlicher Spiegel im Palast begegnete. „Vornehme Blässe“ galt seit jeher als Distinktionsmerkmal privilegierter Oberschichten, aber auch hegemonialer Kultur.9 Die außerordentliche Bedeutung heller Haut zeigt sich auch in der Überlieferung, sodass z. B. pockengezeichnete Gesichter in der Portraitmalerei kaschiert wurden. Besonders im christlichen Abendland wurde helle Haut mit der Jungfräulichkeit Marias und unberührter Jugend in Opposition zum triebhaften „Fleischlichen“ gestellt. Frauen wurden bis in die Moderne hellhäutiger als Männer gemalt, was die geschlechtsdisparate Dimension in dermatologischen Idealisierungen unterstreicht.10 Die Kreation des modernen Menschen entlang seiner Haut, lässt sich nicht nur bildlich, sondern auch als oral history nachvollziehen: So liest etwa der Arzt Ernst Gustav Jung das Märchen von der „Gänsehirtin am Brunnen“ als eine Vergegenwärtigung „idealer, effektiver und unschädlicher Anti-Aging-Behandlung“.11 Eine Signifikante der modernen Klassengesellschaft und Zäsur in der Geschichte der Haut(-pflege) ist jedoch das neue Hygieneverständnis des 19. Jahrhunderts. Über die Qualität der verwendeten Kosmetika unterschieden sich soziale Klassen. Mit dem Aufkommen von „Schönheitsinstituten“ im 20. Jahrhundert (z. B. Schönheitssalon Helena Rubinstein 1912) wurde schließlich eine Brücke zwischen Wissenschaft und kosmetischer Medizin geschlagen. Darüber hinaus wurde durch massenmedialen Popularisierung kosmetischer Behandlungen die Kapitalisierung und — wechselwirkend — Konventionalisierung dermatologischer Normierung vorangetrieben. Dieser Prozess verlief jedoch geschlechtsbezogen asymmetrisch, d.h. das Hautpflege zunächst hauptsächlich als „Frauenthema“ galt und in Zeitschriften wie der „Freundin“ Zug um Zug mit einem zunehmenden kapitalistischen Fortschrittsund Optimierungsstreben regelrecht propagiert wurde.12
Die problematische Wirkmacht hautbezogener Schönheitsideale ist bis in die jüngste Gegenwart spürbar: Besonders in ehemaligen Kolonien entstehen regelrechte „Bleaching-Szenen“.13 Seit den 70er Jahren hat sich mit der Psychodermatologie eine Fachdisziplin herausgebildet, die sich spezifisch mit den psychischen Ursachen und Folgen chronisch entzündlicher Dermatosen auseinandersetzt.14 Dabei werden diese medizinische Spezialisten gleichsam mit den sozialwissenschaftlichen, psychologischen wie post kolonialen Konsequenzen intersektionaler Diskriminierung, d. h. dem Aufeinandertreffen und der Gleichzeitigkeit verschiedener identitätsbezogener Diskriminierungsstrukturen wie Sexismus und Rassismus, konfrontiert.
KONVENTIONALISIERUNG UND KAPITALISIERUNG
Wenn es um das Missverhältnis zwischen der medizinischen Einordnung von Hauterkrankungen zu ihrer breiten Kommunikation gehen soll, kommt der Kosmetikindustrie eine herausragende Rolle zu, u. a. weil sie einen Großteil der massenmedialen Kommunikation über Produktvermarktung besetzt. So betrug der Umsatz in der deutschen Kosmetik- und Körperpflegeindustrie laut IKW (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V.) rund 15 Milliarden Euro im Jahr 2022, davon 4,2 Milliarden auf Hautpflege, was einem Wachstum um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresumsatz entsprach.15 Die Bewerbung von sog. Schönheitspflege macht nach dieser Erhebung ca. 8 Prozent des gesamten Werbevolumens in Deutschland aus.16
So abstrakt die Wirtschaftskraft der Kosmetikindustrie anmuten mag, so signifikant ist der massenmediale Einfluss auf die Formung von sozialer Realität.17 Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann konstatierte in diesem Zusammenhang:
„[Im System der Massenmedien] okkupiert Werbung die Oberfläche ihres Designs und verweist von da aus auf eine Tiefe, die für sie selbst unzugänglich bleibt. […] hier geht es mithin um eine Realitätskonstruktion, die ihre eigene, für sie primäre Realität fortsetzt und dabei erhebliche Schwankungen des Marktes überdauern […] kann.“18
So einzigartig das Konglomerat an Ursachen bei der Hauterkrankten, so allgemeingültig werden dermatologische Produkte in der Masse vermarktet. Oftmals wird diese Art pauschalisierender, normierender massenmedialer Bewerbung dann noch von wissenschaftlichen Studien (z. B. die Werbeaussage „klinisch getestet“) über die (angebliche) Wirksamkeit der Produkte unterstrichen.19 Sowohl bei Unbetroffenen als auch bei Betroffenen manifestiert sich nicht nur das zu erreichende bzw. erstrebende Bild einer „makellosen Haut“, sondern auch der Glaube daran, dass dieses Ideal durch die Verwendung eines bestimmten Produktes erreicht werden könne.
Die Auswirkungen dieses Irrglaubens für die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Hauterkrankten sind verheerend. Eine jüngst auf dem EADV-Kongress (European Academy of Dermatology and Venereology) vorgestellte Studie kam zu dem Ergebnis, dass Gesichter mit Akne als deutlich weniger attraktiv, vertrauenswürdig, erfolgreich, selbstbewusst und dominierend wahrgenommen wurden.20 Weibliche Akne in den Bereichen um Kiefer, Mund und Kinn erhielt in der Wahrnehmung der Befragten die niedrigsten „Attraktivitäts- und Glücklichkeitswerte“, d.h. von Akne betroffene Frauen wurden weniger attraktiv und glücklich eingeschätzt, sogar dann, wenn sie lächelten.
Die zunehmende Forschung innerhalb des Spektrums psychodermatologischer Auffälligkeiten, z. B. Trichotillomanie, Dymorphien; legt ein gesteigertes Problembewusstsein der medizinischen Fachgemeinschaft nahe.21 Auch der Lifestyle-bezogene Missbrauch dermatologischer Medikamente wie Isotretinoin stellt ein signifikantes Problem in unserer Gesellschaft dar.22 Obwohl in der letzten Dekade die Zahl der unter an Akne leidenden Frauen weltweit um 10 Prozent stieg, mithin also die Sichtbarkeit von Akne in der Gesellschaft sichtbar zunahm, kann von einer Normalisierung keine Rede sein.23
Gegen die verzerrte, abwertende Wahrnehmung von dermatologischen Auffälligkeiten als „Unreinheiten“ und der grundsätzlich mangelnden gesellschaftliche Aufklärung im Zusammenhang mit „Hautproblemen“ hat sich mittlerweile eine laute Gemeinschaft gebildet. Unter dem Begriff der „Skinpositivity“ versammeln sich eine Vielzahl von körperpositiven oder -neutralen Aktivist:innen (verschiedenster Herkünfte und thematischer Schwerpunkte), um über Social Media oder analog, z. B. auf Tagungen, mit Betroffenen und Interessierten ins Gespräch kommen, sich über individuelle Schicksale, Therapien, Ausgrenzungserfahrungen usw. auszutauschen. Zugleich schließen sie damit eine Lücke in der (sozio-kommunikativen) Aufklärung über verschiedene Hauterscheinungen, für die sich schlicht bislang keine staatliche Bildungs- und Rechtsinstitution verantwortlich gefühlt hat. Staatliche Institutionen scheinen die Aufklärung über all diese Probleme sogar noch zusätzlich zu erschweren: mit einem BGH Urteil aus 2016 ist rechtlich verbrieft, dass Kosmetikhersteller ihre Werbeaussagen nicht wissenschaftlich belegen müssen.24
„SKIN POSITIVITY“ ODER DISKRIMINIERUNG 2.0?
Die Kosmetikindustrie hat längst das Vermarktungspotential der diversity und body positivity Bewegungen erkannt. Zwar bewerben noch immer überwiegend Models mit unauffälliger, sogenannter „makelloser“ Haut, Produkte für Menschen mit tatsächlichen
Hautauffälligkeiten, aber es wird nun innerhalb der Spektren von unterschiedlichen Hauttypen und -erkrankungen „experimentiert“. So zeigen etwa Luxusmarken wie La Roche Posay in ihren Werbekampagnen, Models verschieden Geschlechts und Alters, mit sehr hellem bis hin zu oliv-farbenem und dunklem Teint. Immer häufiger gehen Kosmetikriesen — wie jüngst Eucerin und Banish — Werbekooperationen mit Menschen ein, deren Gesichter und Körper von Akne, Rosazea, Vitiligo, Schuppenflechte, Dehnungsstreifen und Narben gezeichnet sind. Zweifellos kommen diese Entwicklungen der Abbildung der Realität näher. Doch wie hell scheint der Hoffnungsstern am Himmel der körperpositiven Bewegung wirklich?
Im Hinblick auf die Diversifizierungsstrategien von Hautpflegewerbung gelangt man schnell zu der ernüchternden Einsicht, dass es sich um ein relabeling handelt. Jenes Nebeneinander verschiedener Hautfarben ist häufig nichts Weiteres als das Nebeneinander „europäischer“ Hauttypen; ein Spiel mit Erscheinungsbildern, die zum Teil den Erwartungen eines verinnerlichten Eurozentrismus entspringen dürften. Und selbst bei
Einbezug der „Hauttypen V und VI“, spiegeln diese Werbungen ein Zerrbild zwischen Produktpräsentation und -herstellung, wo doch die meisten kosmetischen Produkte noch immer an und für helle, „europäische“ Haut erprobt werden und damit rassistische Ungleichbehandlung reproduzieren.25 Eine etwas komplexere Symbiose lässt sich hingegen in der Vermarktung von body positivity beobachten. Skinfluencing hat sich zu einem lukrativen Business entwickelt, welches in einem aufklärerischen Selbstverständnis daherkommt und sich damit zugleich von jenen Models abzugrenzen sucht, die schlicht und einfach ihre auffälligen Sommersprossen oder ihre Vitiligo in breit angelegten Werbekooperationen als Markenzeichen kapitalisieren.
Sie führen uns allerdings nicht alleine Produktreihen vor, die sich kein:e Normalsterbliche:r leisten kann und auf die Versprechen von gestern abheben, denn sie profitieren von einem weit gesponnen Netzwerk. Viele der besipielsweise von Eucerin Deutschland abonnierten Accounts lassen sich als „Hautgesundheitscoaches“ bezeichnen und bieten Programme an, die von Meditation über „Herbalism“ bis hin zu Astrologie und „Moonenergy“ reichen. Haut lässt sich beliebig mit jedem Lifestyle Thema verbinden, in kostspielige „Pflegereihen“ ummünzen, alles amalgamiert zu einer riesigen Wertschöpfungsmaschinerie. Teil dieser Wertschöpfungsmaschinerie zu sein, bedeutet dann wiederum einflussreich unsere Werbeumwelt zu gestalten, die diskriminierende Bilder(-sprache) mit der wir alltäglich konfrontiert werden und Einfluss auf Verfügbarkeiten von Produkten zu nehmen. Die Hautpflegeindustrie verdient am Leid Betroffener, in dem sie Stigmata wie den „Unreinheitsmythos“, die zu ihrer Ausgrenzung führen, nicht nur bespielen, sondern reproduzieren und in der Gegenwart stetig neu reproduzierbar machen. Zuletzt sei auf die Frage zurückgekommen: Warum muss unsere Haut in der gesamtgesellschaftlichen Dimension betrachtet werden? Zunächst einmal lässt sich festhalten, dass unsere Haut als größtes und verletzliches Organ Schutz, Versorgung und Wertschätzung bedarf. Ihre Kondition macht einen bedeutenden Teil unseres äußeren wie inneren Erscheinungsbildes aus. Hinter der sozialen nicht medizinischen Bewertung des Hautzustandes (der oft innerhalb weniger Sekunden geschieht), stecken (un-)mittelbare, häufig tiefgreifende Bewertungen einer Persönlichkeit. Wir codieren Personen aufgrund ihrer Haut zwischen gesund/ungesund, rein/unrein, normal/unnormal, attraktiv/unattraktiv, wobei intersektionale „Identitätsmarker“ in dieser Codier-logik stets mitwirken. Durch diese Dichotomien werden Persönlichkeiten entweder auf- oder abgewertet. Die Normalisierung von Hautauffälligkeiten ist mithin nicht weniger als ein direktes Anliegen gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe, gleicher Chancen auf dem Arbeitsmarkt und bei Bewerbungssituationen, bei der Umgestaltung politischer Kampagnen und kapitalistischem Produktmarketings, beim Dating, bei der Anerkennung sichtbarer und unsichtbarer chronischer Leiden von Hauterkrankten im alltäglichen Leben. Diese Normalisierung kann ebenso im individuellen Einflussbereich wie über Social-Media-Communities geschehen. Wo allerdings skin positivity zu skinfluencing wird, überwiegt häufig das Profit- dem Aufklärungsinteresse.
- Vgl. www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Dermokosmetik
- www.dermasence.de/ratgeber/dermasence-wissen/blog/die-haut-alsspiegelbild-der-seele www.eucerin.de/ueber-eucerin/purpose
- www.sebamed.de/produkte/unreine-haut
- www.dermasence.de/meine-haut/hauttyp/unreine-haut-akne
- Wenn die Folgeerkrankungen wie psychische Erkrankungen in dieses Verständnis mitreinzählen: www.cosmosdirekt.de/risikolebensversicherung/volkskrankheitenpraevention/
- Verharmlosung kann zur Verschlimmerung, Fehldiagnose usw. führen: z.B. www.springermedizin.de/seltene-erkrankungen/acne-inversa/acneinversa-eine-seltene-erkrankung-mit-weitreichenden-auswirku/19360702 www.vice.com/de/article/evyjmp/akne-ist-mehr-als-pickel-es-ist-einescheisskrankheit
- Mußgnug, D., Nothelfer der Haut in der christlichen Ikonographie, in: Jung (2007), Kleine Kulturgeschichte der Haut, S. 25.
- Wietig et al., Kulturgeschichtliche Aspekte heller Haut, in: Jung (2007), Kleine Kulturgeschichte der Haut, S. 121.
- Ders., S. 120.
- Wietig et al., Zum ästhetischen Wertewandel in Kultur und Kosmetik, Jung (2007), Kleine Kulturgeschichte der Haut, S. 191.
- Jung (2007), Kleine Kulturgeschichte der Haut, S. 41.